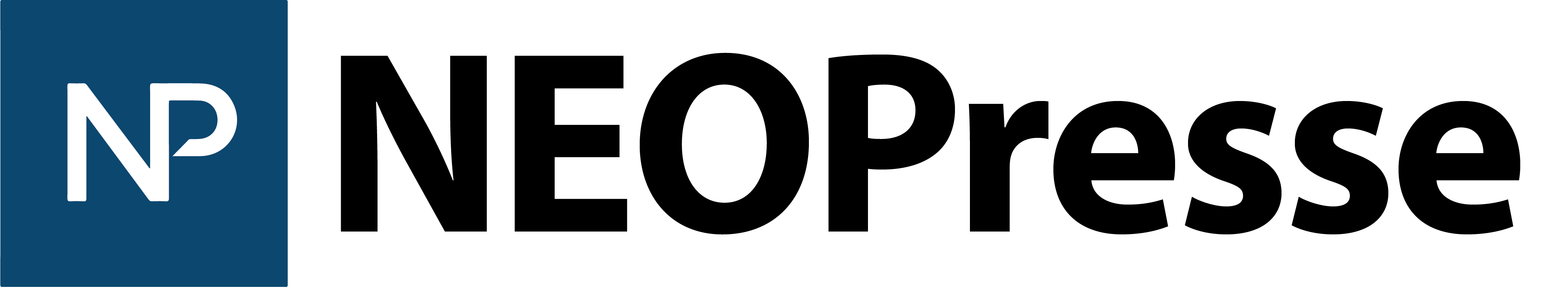DSahra Wagenknecht, die schillernde Gründerin des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), zog sich vom Parteivorsitz zurück – nicht ohne zuvor noch einmal kräftig auszuteilen. Ihre Diagnose für Deutschland fiel vernichtend aus: Das Land befinde sich in einem Zustand, der sie fatal an die Endzeit der DDR erinnere. Dieser Vergleich, von jemandem, der seine politische Sozialisation in einer SED-Nachfolgepartei hatte, entfaltet eine besondere Wucht. Wagenknecht sprach von einer politischen Klasse, die sich systematisch selbst betrüge, offensichtliche Missstände schönrede und unfähig sei, drängende Probleme überhaupt als solche anzuerkennen. Es sei der Zustand einer saturierten Elite, die lieber Narrative pflege, als Verantwortung zu übernehmen.
Der dritte Bundesparteitag des BSW zeigte deutlicher als je zuvor die inneren Spannungen einer Partei, die erst am Anfang steht, aber schon mit klassischen Problemen etablierter Parteien ringt. Wagenknechts persönliches Credo – lieber Opposition als faule Kompromisse – kollidierte mit den Ambitionen einiger Landesverbände, die in Regierungsverantwortung drängen und darin die Chance sehen, politischen Einfluss real auszuüben. Diese Kollision führte zu einem Zwiespalt zwischen ideologischem Anspruch und politischer Realität. Je mehr das BSW in konkrete Machtkonstellationen hineingezogen wird, desto stärker zeigen sich die Widersprüche: Kompromisse, programmatische Verwässerung und interne Machtspiele.
Der Auftritt von Steffen Schütz führte diese Konflikte geradezu exemplarisch vor Augen. Seine Warnung, aus einer 16-Prozent-Partei keine Zwei-Prozent-Partei zu machen, stieß auf Buhrufe – ein deutliches Zeichen, dass große Teile der Basis eine klare, kompromisslose Linie bevorzugen. Viele Mitglieder scheinen zu fürchten, dass das BSW in den Mahlstrom des politischen Alltags gerät und dabei seine Unverwechselbarkeit verliert.
Deutschland wie die DDR?
Besonders brisant wirkt die Debatte um die sogenannte Brandmauer zur AfD. Die Abwahl großer Teile des Landesvorstands in Sachsen-Anhalt – gerade jener, die auf einer kompromisslosen Abgrenzung bestanden – verdeutlicht, wie tief der Riss im Inneren der Partei verläuft. Der vielzitierte Satz „Die Brandmauer ist tot – aber keiner will es zugeben“ spiegelt eine Entwicklung wider, die sich quer durch die politische Landschaft zieht: Die alten Frontlinien verlieren an Bedeutung, während neue Konflikte entstehen, die sich weniger an Parteigrenzen als an Sachfragen und gesellschaftlichen Realitäten orientieren.
Viele Bürger empfinden die starre moralische Aufladung der politischen Debatte längst als künstlich. Die jahrelange Ausblendung realer Probleme – von der Migrationskrise über Energiepolitik bis hin zur wirtschaftlichen Stagnation – hat einen Vertrauensverlust erzeugt, den keine Brandmauer der Welt mehr kitten kann.
In ihrer Abschiedsrede zeigte sich Wagenknecht ungewohnt selbstkritisch. Sie räumte ein, dass die restriktive Mitgliederaufnahme weder Karrieristen ferngehalten noch innerparteiliche Netzwerke verhindert habe. Stattdessen bestehe die Gefahr, dass das BSW als bloße Neuauflage jener linken Strukturen wahrgenommen werde, von denen man sich doch eigentlich absetzen wollte.
Ihre härteste Kritik galt jedoch der Bundesregierung. Wagenknecht zeichnete das Bild eines Landes, das seine elementaren Aufgaben nicht mehr erfüllt: offene Grenzen, wirtschaftliche Selbstschädigung, wachsende Kriminalität und eine politische Elite, die sich lieber mit Kulturkampf-Themen wie Gendern oder Klimasymbolik beschäftigt. In diesem Zusammenspiel aus Realitätsverweigerung, moralischer Überheblichkeit und politischer Handlungsunfähigkeit erkennt sie Parallelen zu den Spätjahren der DDR – einem System, das an seinen eigenen Illusionen zerbrach.