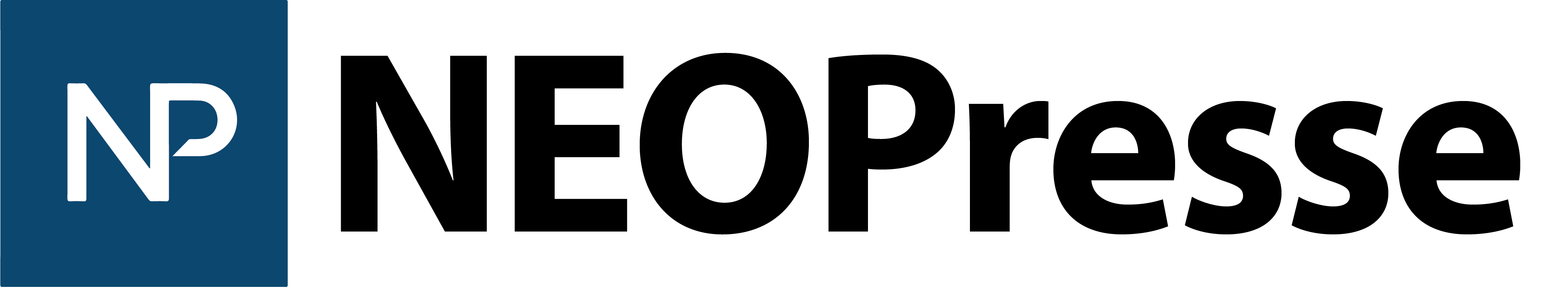Die Forderung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Krisenvorsorge in den Schulalltag zu integrieren, zeigt, wie tief sich das Gefühl der Unsicherheit in unsere Gesellschaft eingeschrieben hat. Schulen, einst Orte der Bildung und Geborgenheit, sollen nun zu Trainingsstätten für Ausnahmezustände werden. Wenn schon Kinder lernen müssen, wie man sich bei Blackouts, Cyberangriffen oder gar bewaffneten Konflikten verhält, ist das mehr als nur eine pädagogische Maßnahme – es ist ein stilles Eingeständnis staatlichen Versagens.
Gerda Hasselfeldt vom Deutschen Roten Kreuz hält „ein paar Stunden Schulung pro Jahr“ für unproblematisch. Doch was wird da wirklich vermittelt? Einfache Verhaltensregeln – oder das Bewusstsein, dass der Staat seine Schutzfunktion zunehmend an die Bürger selbst delegiert? Der Gedanke, dass Grundschüler sich künftig mit Fluchtwegen und Notrationen befassen sollen, hat etwas zutiefst Beunruhigendes.
Georg Khevenhüller vom Malteser-Hilfsdienst spricht davon, man müsse sich „den Realitäten stellen“. Doch welche Realitäten sind gemeint? Die Realität geopolitischer Instabilität, wachsender Energieabhängigkeit und zunehmender sozialer Spannungen? Die Politik spricht von „Resilienz“, meint aber oft nur das passive Ertragen einer Entwicklung, die sie selbst mitverursacht hat, heißt es in Medien bzw. sozialen Medien teilweise.
Sabine Lackner vom Technischen Hilfswerk betont, es gehe nicht um Angst, sondern um Wissen. Das mag stimmen – doch Wissen ersetzt keinen Schutz. Es ist das Symptom einer Gesellschaft, die sich an Krisen gewöhnt hat, anstatt sie zu verhindern.
Wenn Kinder lernen müssen, in der Krise zu funktionieren, statt in Sicherheit aufzuwachsen, dann ist die eigentliche Krise längst da, meinen Kritiker solcher Maßnahmen. Die